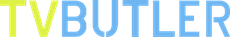Punkt eins Die Hölle auf Erden
Mi, 06.08. | 13:00-13:55 | Ö1
6. August 1945, 8 Uhr 16 und 2 Sekunden: Eine Atombombe detoniert über der japanischen Küstenstadt Hiroshima. Drei Tage später trifft es Nagasaki. Geschätzte 100.000 Menschen sind nach dem Abwurf der beiden Atombomben durch die US-Air Force sofort tot; weitere 130.000 sterben an Folgeschäden allein bis Ende 1945. Städte werden ausradiert. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Land, die USA, die apokalyptische Kraft einer Atombombe gegen ein anderes, Japan, eingesetzt – um es zur Kapitulation zu zwingen und den Zweiten Weltkrieg auch in Asien zu beenden. 80 Jahre später könnte die Menschheit sich mühelos durch atomare Schläge auslöschen und eine verwüstete Welt hinterlassen. Mit Drohungen, Atomwaffen einzusetzen, hielten sich im Kalten Krieg die USA und die Sowjetunion gegenseitig in Schach. „Letztlich hat das Prinzip der Abschreckung funktioniert“, sagt der Nuklearforscher Georg Steinhauser von der TU Wien kürzlich in einem Interview mit dem „Standard“: „Aber mit jedem neuen Player steigt die Unsicherheit und die Unberechenbarkeit.“ Laut dem jüngsten Sipri-Jahresbericht (Stockholm International Peace Research Institute) besitzen neun Staaten heute schätzungsweise 12.241 Atomwaffen, wobei etwa 9614 als potenziell einsatzbereit gelten. Davon seien 3912 strategische Atomwaffen mit operativen Streitkräften verbunden. Das Friedensinstitut sieht demnach Anzeichen für ein neues nukleares Wettrüsten. Abgesehen von der „Zeitenwende“ durch die Atombombenabwürfe in Japan gibt es weitere historische Daten, die sich im Zusammenhang mit Atomenergie ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben: die Atomkatastrophe am 26. April 1986 in Tschernobyl und der Atomunfall von Fukushima am 11. März 2011 infolge eines Seebebens. Beide Orte – Tschernobyl und Fukushima – wurden zu Symbolen entfesselter atomarer Prozesse, über die der Mensch die Kontrolle verloren zu haben schien. Und dann gibt es noch ein Atoll im fernen Pazifik: Mururoa. Seine Übersee-Départements nutzte Frankreich 30 Jahre lang als Atomwaffentestgebiet und zündete dort 188 Atombomben, einige davon mit ungleich höherer Sprengkraft als die Bombe von Hiroshima. „Nichts wissen sollte die Welt dagegen von den hässlichen Pannen der Grande Nation bei all ihren nuklearen Gehversuchen“, heißt es dazu in einem „Spiegel“-Artikel, der an Frankreichs selbstherrliche Haltung erinnert: „Bomben lösten Erdrutsche und einen Tsunami aus, der Inseln verwüstete. 1974 kam es über Tahiti, 1200 Kilometer von Mururoa entfernt, zwei Tage lang zu Fallouts, radioaktivem Regen; die Plutonium-Belastung überschritt den Grenzwert ums 500-fache“. Das offizielle Frankreich wiegelte ab: Die Tests seien „weniger gefährlich als die Strahlung von Fernsehgeräten“. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine nukleare Eskalation? Ist die nukleare Abschreckungs-Strategie noch wirksam? Fühlen Sie sich gut und glaubwürdig informiert über den Bestand der Atomwaffen-Arsenale weltweit? Mit welchen Gefühlen denken Sie an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 zurück? Alexander Musik diskutiert mit dem Nuklearforscher Univ.-Prof. Dr. Georg Steinhauser über die Schwierigkeiten, zu genauen Opferzahlen nach Tschernobyl zu kommen, die Wirksamkeit der atomaren Abschreckung und die Langzeitfolgen von Nuklearunfällen. Rufen Sie uns an unter 0800 22 69 79 während der Sendung oder schreiben Sie uns unter punkteins(at)orf.at.
in Outlook/iCal importieren